Ein leuchtendes Pantheon – Religion in High-Fantasy-Romanen
- Kornelia Schmid
- 17. Okt. 2024
- 8 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 22. März
Braucht eine High Fantasy Welt immer auch eine Religion oder mehrere? Sind die Götter nur Konstrukte oder gibt es sie wirklich? Greifen sie in die Belange der Menschen ein? Und wenn ja, sind sie ihnen dann wohlgesonnen? Das sind Fragen, die sich Autor:innen stellen sollten, wenn sie einen High Fantasy Roman schreiben. Ich trage ich ein paar Infos zu Religionen und Göttern zusammen.

Monotheismus, Polytheismus oder irgendwas dazwischen? Je nachdem, wofür man sich entscheidet, hat das einen großen Einfluss auf die Fantasywelt. Denn in der Regel gibt es gute Gründe, eine monotheistische Religion zu entwerfen – oder eben nicht. Über diese Gründe sollten sich Autor:innen im Klaren sein. Im Folgenden zeige ich anhand einiger Buchbeispiele, wie man in High Fantasy Romanen mit Religion arbeiten kann.
Polytheistische Religonen für buntes Worldbuilding
Zumindest in der westlichen Welt dürften den meisten Menschen polytheistische Vorstellungen fremd und exotisch erscheinen. Für das Ausgestalten von Fantasywelten können solche Fremdheitseffekte sehr nützlich sein – die Welt soll schließlich keine Kopie unserer sein, sondern eigene Dynamiken entfalten, sie soll sich tatsächlich anfühlen, als könnte sie unabhängig von unserer existieren. Oft zeigen entsprechende Entwürfe Reiche, die nicht vom Christentum oder vom Islam überrollt wurden. Wie könnte ein Mittelalter ohne Kirche aussehen? Wäre das überhaupt denkbar?
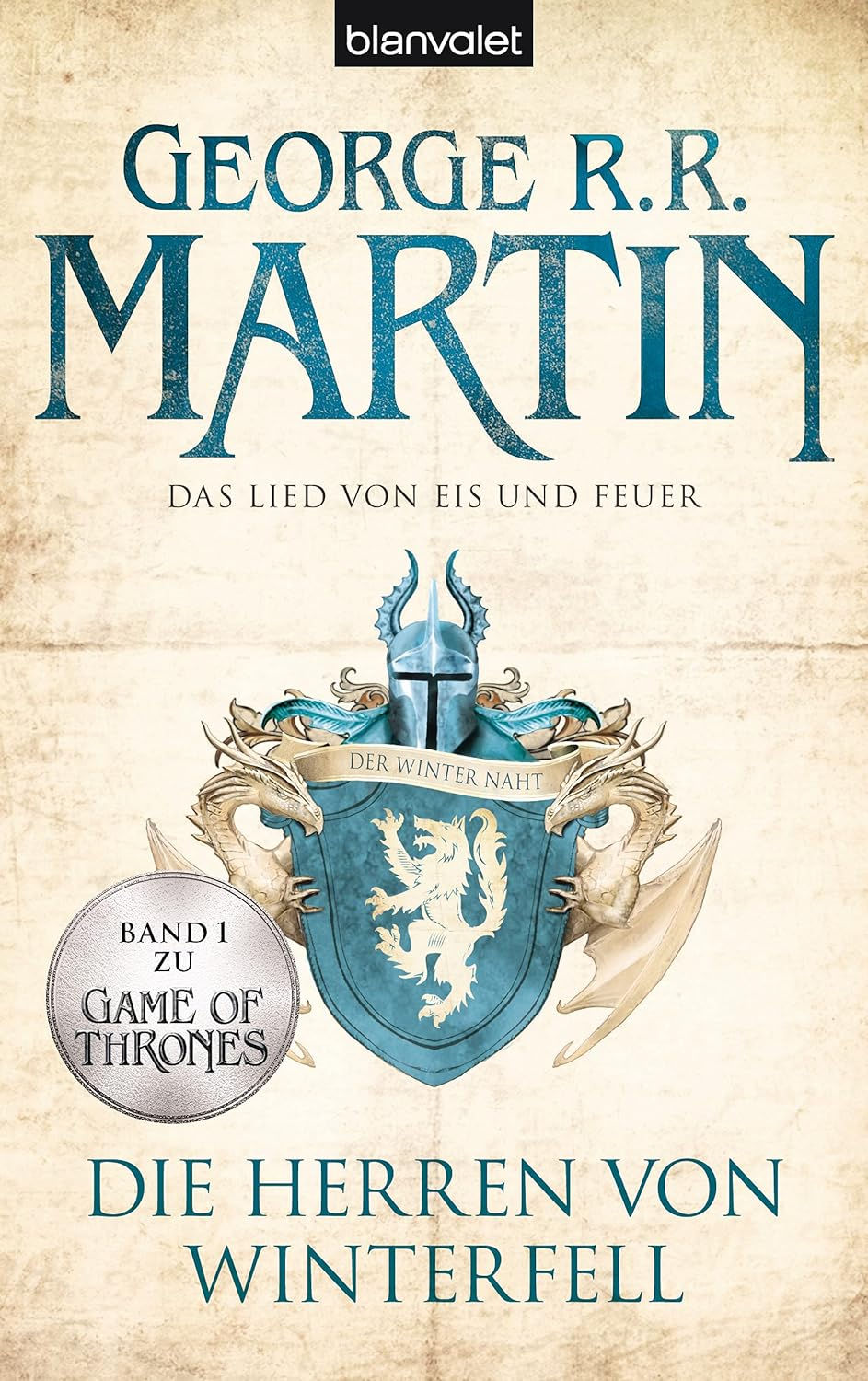
In George R. R. Martins "Das Lied von Eis und Feuer" verehren die Menschen unterschiedliche Gottheiten. In Westeros etabliert ist ein Pantheon aus sieben Göttern. Im Norden werden zusätzlich oder parallel "die alten Götter" verehrt. Die roten Priester huldigen einem einzigen Gott, die Gesichtslosen vielen Götter als einem Einzigen. Im Laufe der Handlung scheinen sich zumindest die sieben Götter lediglich als kulturelles Kunstrukt zu entpuppen– es gibt nirgendwo Hinweise für ihre Existenz oder ihr Eingreifen. Bei den anderen Gottheiten ist das nicht so klar. Die alten Götter stehen in Verbindung mit dem Geistaussenden, der vielgesichtige Gott mit Gestaltwandeln und der Gott der roten Priester scheint alles Mögliche bewerkstelligen zu können, bis hin zur Wiederbelebung von Toten. Insgesamt bleiben die Götter aber geheimnisvoll und vage.
Wichtig ist: die mutmaßlich existenten Gottheiten stehen in engem Zusammenhang mit dem Magiekonzept. Ohne sie gäbe es auch keine magischen Fähigkeiten. Und so werden die Götter elementarer Bestandteil des Worldbuildings.
Mehr zu Magiesystemen könnt ihr auch hier lesen: https://www.kornelia-schmid.de/post/magiesysteme-in-high-fantasy-romanen.

Die Menschen wurden in Bernhard Hennens "Elfen-Romanen" von den Devanthar geschaffen, die Elfen von den Alben. Während sich die Alben weitgehend aus der Welt heraushalten, sind die Götter der Menschen munter am Tun. Die Devanthar sind dabei nicht abstrakt, sondern treten regelmäßig körperlich auf. In "Drachenelfen" ist jedes Menschenvolk einem bestimmten Gott zugeordnet, der Glaube wird somit per Geburt definiert.
Hier liegen also nicht die Religionen selbst im Widerstreit miteinander, sondern vielmehr die Götter als ihre launischen Verkörperungen. Die Götter sind mächtige Wesen, aber nicht übernatürlich und so können sie auch getötet werden. In gewisser Weise hebt sich die Funktion des Glaubens damit auf, sodass man vielleicht auch argumentieren könnte, dass es hier eigentlich gar keine Religion gibt.
Die beiden Beispiele zeigen, dass im Bereich "Polytheismus" fantastische Religionen nicht unbedingt Konfliktträger sind, sondern vielmehr ein Element des Worldbuildings, das gleichrangig ist bzw. sich bezieht auf Kultur, Alltagsleben und Historie der Bewohner einer fiktiven Welt. Kurz gesagt: Die Religion existiert einfach, weil Leser*innen erwarten, dass eine Religion existiert. Und wenn sie schon existiert, dann kann man sie natürlich auch ein wenig in den Plot verweben, ohne ihr dabei aber zu viel Raum zu geben.
Monotheistische Religionen als Machtmittel
Der Monotheismus hat eine lange Geschichte und ist uns bestens bekannt. Die drei Weltreligionen sind monotheistisch. Die meisten Gläubigen unserer Welt dürften also an einen einzigen Gott bzw. eine einzige höhere Macht glauben. Es liegt natürlich nahe, solche Vorstellung auch in eine Fantasywelt zu integrieren. Dass eine Kirche, die einen einzigen Gott verehrt, vertraut wirkt, kann dabei ein Vorteil sein.

Die Welt, in der "Kinder des Nebels" von Brandon Sanderson spielt, wird schon seit Jahrhunderten von einem unsterblichen Herrscher regiert, einem Gott. Doch es ist eine düstere Welt: In der kargen Landschaft gibt es keine Pflanzen, Nebel verhüllt sie und Ascheflocken fallen vom Himmel. Der Großteil der Menschen ist versklavt und wird von der Oberschicht unterdrückt. Längst schwähren revolutionäre Gedanken, doch wie könnte man einen Umsturz herbeiführen? Wie einen Gott besiegen? Richtig, mit einem zweiten Gott. Doch der muss erst einmal geschaffen werden.
Religion ist hier Machtmittel und dieses kann von beiden Seiten genutzt werden: von den Herrschenden und den Beherrschten. Außerdem ist Religion so zentral in der Psyche der Menschen dieser Welt verankert, dass ohne sie ein Umsturz nicht denkbar wäre – obwohl die Sklaven doch schon längst weit in der Überzahl sind. Denn wäre der Herrscher nicht göttlich, sondern einfach nur ein Mensch, würde sein System wahrscheinlich nicht funktionieren – und der Roman auch nicht.

In den "Powder-Mage-Chroniken" von Brian McClellan gibt es einen einzigen Gott: Kresimir. Dieser besitzt auch seine eigene Kirche, deren Vertreter für die korrekte Ausübung der Religion sorgen. Der Gott selbst weilt nicht mehr auf Erden und greift auch nicht in die Handlung ein – zunächst. Denn, wie sich herausstellt, sind Götter ganz real, früher gab es mehrere von ihnen und zumindest einer existiert neben Kresimir – allerdings ohne Gläubige um sich zu scharen und Macht auszuüben. Nun kehrt Kresimir jedoch zurück auf die Welt. Und er ist nicht wohlgesonnen, nicht einmal seiner Kirche, wie es scheint.
Religion verweist hier also nicht unbedingt auf Übernatürliches, sondern wird schnell zur dunklen Bedrohung. Viele Romane handeln vom Kampf gegen einen bösen Herrscher. Und wie viel dramatischer ist es, wenn dieser ein unbesiegbarer Gott ist! Religion ist damit für den Konflikt des Romans entscheidend. Und für die Spannungskurve ist es zentral, dass Kresimir eben nicht einer unter vielen ist, sondern als scheinbar einziger Gott universelle Macht innehat.

Auch in Brent Weeks "Licht-Saga" spielt der Glaube an den Schöpfer Orholam eine wichtige Rolle. Sein Prophet Lucidonius hat die Welt, wie sie in den Romanen dargestellt ist, geformt. Alles Wissen über die Natur und die Vorgänge, die in ihr stattfinden (und im Falle der Romane betrifft das eben auch Magie) wird von der Kirche kontrolliert – (Natur-)Gesetze, die der Kirche nicht in den Kram passen, weil sie die Macht der Organisation bedrohen, als "ketzerisch" abgestraft, verboten und getilgt.
Der Monotheismus steht hier somit für ein Mittel der Unterdrückung. Die Welt wird zugunsten des Machterhalts einer bestimmten Schicht verzerrt dargestellt. Machtvolle Magie, die die Ordnung gefährden könnte, wird unter Verschluss gehalten. Will die Welt frei sein, muss auch die Religion zerstört werden. Und dabei wird diese mit ihren eigenen Waffen geschlagen: Der prophezeite Erlöser ist schon unterwegs. Glaube kann hier, wie es scheint, nur durch Glauben zerstört werden. Der erste Messias hat die Welt aus dem Lot gebracht, der zweite muss sie wieder geraderücken. Der Roman zeigt damit gut das zerstörerische Potenzial von institutionalisierter Religion, ohne sich dabei von ihr fortzubewegen.

"Das Licht aus dem Nebel" spielt in einem Reich, das sozusagen säkularisiert wurde. Früher spielte Religion noch eine Rolle, zur Zeit, in der die Geschichte angesiedelt ist, hat sie jedoch der Aufklärung Platz gemacht und ist weitgehend verschwunden. Die Herrscher regieren nicht von Gottes Gnaden, sondern aus eigener Kraft heraus (nämlich durch ihre ausgeprägte magische Begabung). Sie fördern die Wissenschaft und bekämpfen Aberglauben. Doch das funktioniert nur bedingt, denn Menschen neigen dazu, an höhere Mächte zu glauben, so auch im Roman. Der Gedanke, dass "schwarze Magie" nicht nur eine andere Art, Magie zu kanalisieren, sondern eben dämonisch sei, hält sich hartnäckig. Hinzu kommt ein Prophet, der sich als Auserwählter einer vergessenen Göttin bezeichnet und hinter sich Anhänger schart.
Die Religion dient also als Gegenpol zu der Haltung der Herrscher. Religion ist hier hochpolitisch. Sie ist letztlich ein Vorwand, die Herrscher zu stürzen. Dafür reicht auch eine einzige Göttin. Denn es geht darum, individualistische Bestrebungen, wie sie die Herrscher vorantreiben, zugunsten eines Kollektivs aufzugeben. Dafür eignet sich der Monotheismus bestens – denn wenn alle an einen bestimmten Gott glauben, haben sie mehr gemeinsam, als wenn es verschiedene Götter gibt, aus denen man wählen kann. Religion ist wieder einmal Machtinstrument und treibt die Konflikte voran.
Na, fällt euch etwas auf? Richtig, bei all diesen Konzepten geht es letztendlich um Macht. Egal, ob eine Religion nun missionarisch ist oder nicht – die Beschränkung auf eine einzige Gottheit allein scheint provokant und bietet Konfliktstoff. Denn wer kann schon wissen, was da wirklich ist? Auch ruft die Reduktion auf nur eine Gottheit schnell Institutionen auf den Plan, die Dogmen und Regeln schaffen. Und wer Macht über den Glauben hat, hat Macht über Menschen. Dass Macht nur allzu schnell korrumpiert, ist hinlänglich bekannt.
Die großen monotheistischen Religionen unserer Zeit, das Christentum und der Islam, haben sich in ihrer Geschichte nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Christentum hat Kreuzzüge und Inquisition zu verantworten, ist bekannt für korrupte Priester und auch heute tauchen immer noch Berichte über Missbrauch auf. Der Islam dient in vielen Ländern als Rechtfertigung, Frauen und Andersgläubige brutal zu unterdrücken und hat eine Reihe terroristischer Organisationen hervorgebracht. Genug Zündschoff also, um sich in Hinblick auf Romane an historischen oder auch zeitgenössischen Begebenheiten zu bedienen.
Archaische Glaubensvorstellungen
Der Polyhteismus der Antike oder Bronzezeit mag alt wirken, doch er ist letztlich eine Weiterentwicklung noch älterer Vorstellungen. Personifizierte Götter müssen erst einmal entstehen – und waren davor wahrscheinlich Geister, die die Natur durchdringen und deren Wirken sich in Wetterphänomenen, Geburt und Fruchtbarkeit sowie im Sterben äußert. High Fantasy Romane bieten natürlich auch die Möglichkeit, auf diese Stufe zurückzugehen und Religion als eine Art Naturkraft zu thematisieren. Diese wirkt in der Regel so intuitiv, dass sie auch keiner starren Institution bedarf, wenngleich die Ausübung bestimmter Rituale wohl naheliegen dürfte. Priester:innen sind dann vielleicht zugleich auch Heiler:innen oder Hebammen, Einbalsamierer:innen oder Bestatter:innen, vielleicht auch Köch:innen oder Krieger:innen und präsentieren ihre Erfolge als Form göttlichen Wirkens.

In "Der letzte Winter der ersten Stadt" von Rafaela Creydt treffen verschiedene Kulturen aufeinander. Der Protagonist Krai glaubt daran, dass die Natur von Geistern bevölkert ist, die Einfluss auf Mensch, Tiere und Dinge nehmen bzw. sie bewohnen. Demgegenüber glaubt die zweite Hauptfigur Neshka an Götter, die in das Geschehen der Welt eingreifen. Die unterschiedlichen Glaubensentwürfe sorgen nicht nur für Konflikte, sondern führen zu dramatischen Verwicklungen. Denn Krai hat für die Existenz der Geister keinen Beweis, tut aber alles (und ich meine damit wirklich alles), um sie zu besänftigen.
Der archaische Glaube, der hier dargestellt wird, dient also dazu, die Figur zu charakterisieren und die kulturelle Kluft zu vergrößern. Er ist ganz klar ein Element, das für außerordentliche Konflikte sorgt, die die Romanhandlung immer weiter vorantreiben. Zu sagen, der Glaube gehört einfach zum Worldbuilding, wäre deshalb zu kurz gegriffen, weil ohne ihn die Handlung nicht funktionieren würde.

"Die Silben der Magie" von Thomas M. Adler erzählt von Kolonialismus. Ein Reich will seinen Machtbereich in die Südsee ausdehnen und landet auf einer Insel, um dort einen Stützpunkt zu errichten. Diese ist jedoch bereits bewohnt, also werden die Einheimischen schlichtweg attackiert, getötet und versklavt. Der Protagonist gehört zu den Eroberern, schlägt sich jedoch auf die Seite der Einheimischen, nachdem er sie und ihre Kultur kennengelernt hat. Der Roman zeichnet einen Kontrast zwischen der "zivilisierten" Welt, die jedoch von Brutalität, Ausbeutung und Machtstreben geprägt ist, und der Welt des Inseldorfes, in der die Menschen friedlich im Einklang mit der Natur leben (so zumindest das Narrativ). Dazu gehört natürlich auch eine Religion, die die Natur selbst zur Gottheit erhebt, ohne es nötig zu haben, diese zu personifizieren und ihr einen Namen zu geben.
Die Religion repräsentiert hier also eine bestimmte Lebensweise, die der Roman als positiv zeichnet. Der Glaube der Einheimischen wird dabei jedoch nicht verklärt – der Protagonist ist schließlich Wissenschaftler und damit Vertreter einer aufgeklärten Weltsicht. Religion und Lebensweise verschmelzen vielmehr. Was genau hier geglaubt wird, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist die friedliche Grundhaltung, die den Entwurf erstrebenswert macht. Letztlich geht es hier also genau wie in "Der letzte Winter der ersten Stadt" um eine Gegenüberstellung von Positionen. Es geht um Gut und Böse. Und "Gut" ist dabei nicht die Religion. "Gut" sind die Menschen, die sie ausüben. Ob die Natur als eigenständige Macht denn tatsächlich existiert und eingreift, lässt der Text deshalb auch offen.
Fantasywelten sind selten so archaisch, dass derartige Religionen im Zentrum stehen. Doch es bietet sich natürlich an, sie als Kontrastelemente anzulegen. Archaische Religionen sind oft Relikte einer vergangenen oder im Vergehen begriffenen Zeit. Demgegenüber stehen dann "moderne" polytheistische oder monotheistische Religionen. Und wenn Altes und Neues aufeinandertreffen sorgt das immer für Konflikte.
Apropos: Wer sich fragt, warum denn Konflikte so wichtig sind, findet hier meine Beiträge zum Thema "Spannung erzeugen" und "Dialoge schreiben": https://www.kornelia-schmid.de/post/spannung-in-romanen-erzeugen und https://www.kornelia-schmid.de/post/dialoge-schreiben.
Gibt es die Götter wirklich?
Viele Fantasybücher liefern letztlich rationale Erklärungen für Götter und ihr Wirken. Denn Welten, die durchdrungen sind von Magie, behergen die ein oder andere Gottheit womöglich auch ganz real. Und so treten die Götter auf und greifen in die Handlung ein. Das kann ganz geheimnisvoll passieren wie im "Lied von Eis und Feuer" oder aber sehr greifbar wie in den "Drachenelfen". Und so haben die meisten Fantasyromane Eines gemeinsam: Sie betrachten etwas, das in unserer Welt übernatürlich ist, und nehmen ihm dann den Zauber. Klingt paradox? Ist es nicht. Denn das zentrale Anliegen der Fantastik ist letztlich die Reflexion unserer Welt. Auch wenn sie dafür oft weiter ausholt.

Comments